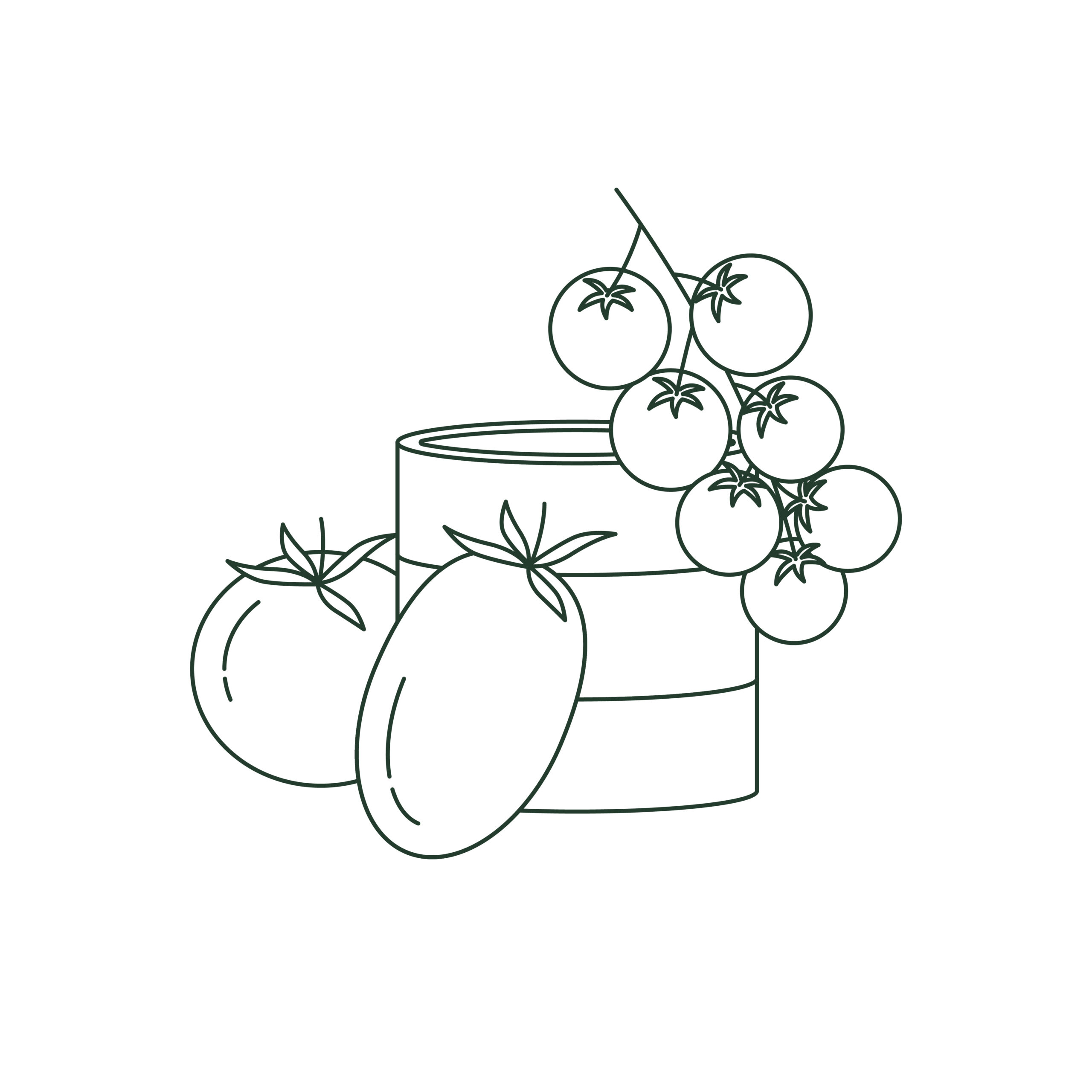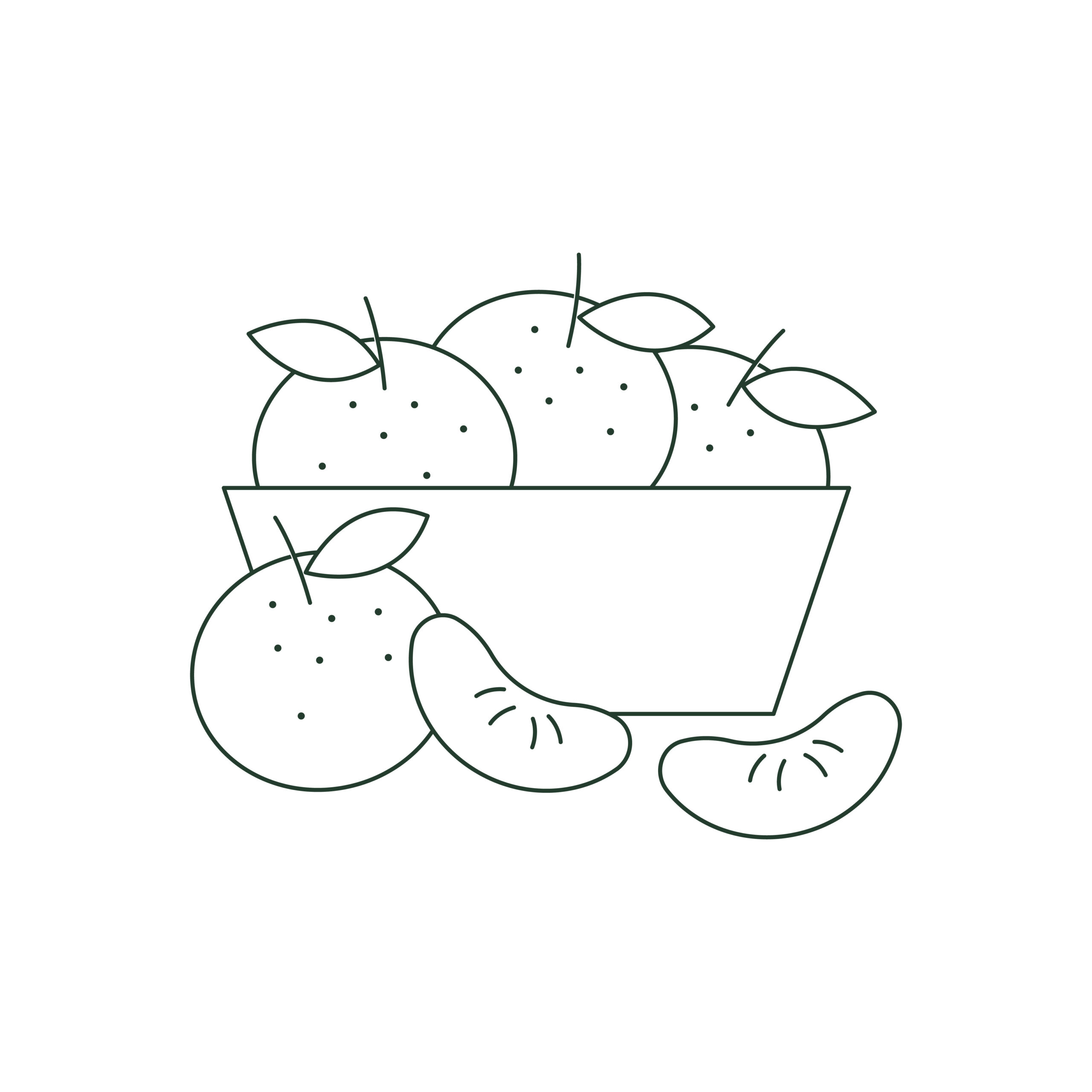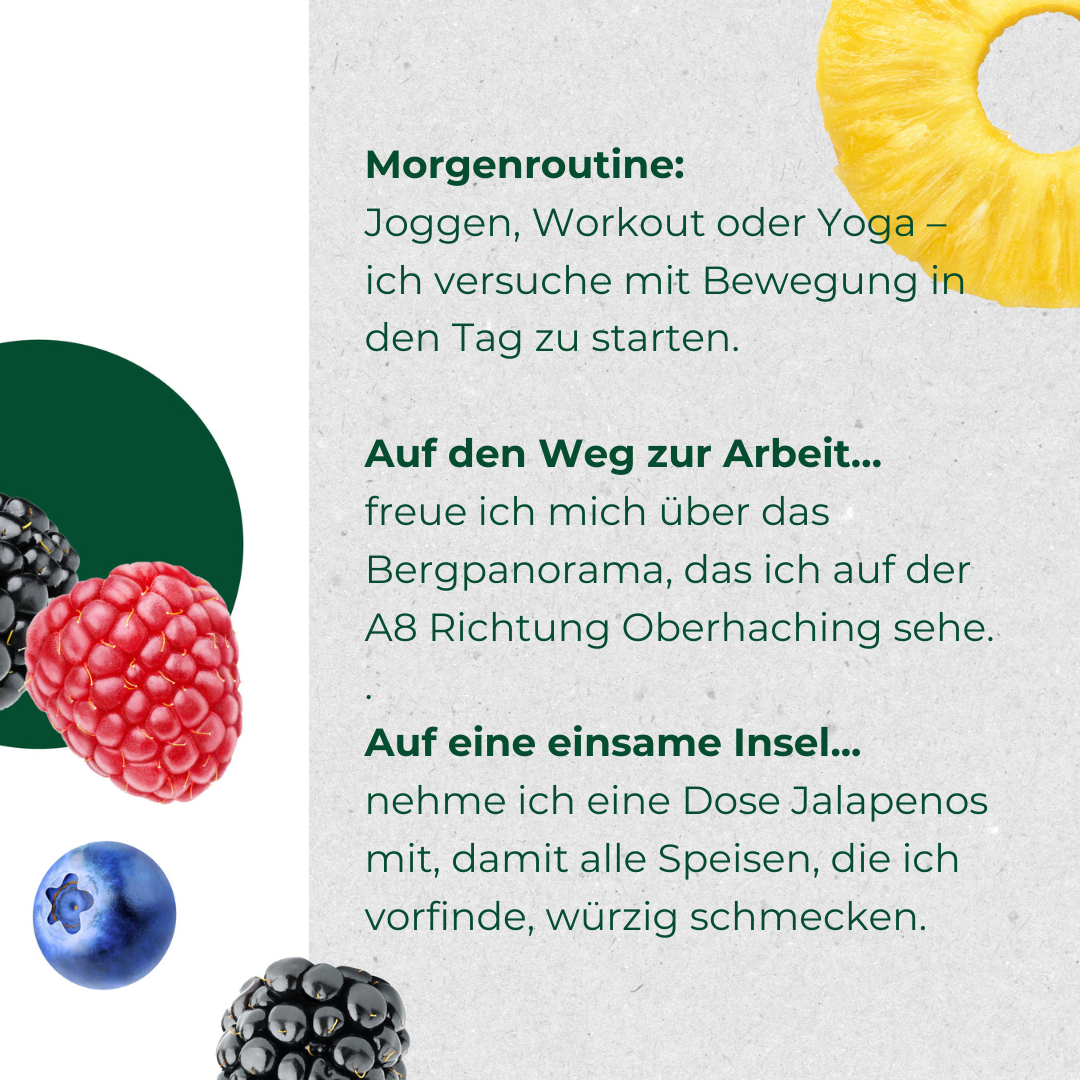Herr Böhm, Ihre berufliche Laufbahn hat Sie um die halbe Welt geführt. Was waren die Stationen, die Sie besonders geprägt haben?
Nach meiner Ausbildung zum Speditionskaufmann zog es mich früh ins Ausland – erst nach England, dann nach Hongkong und Korea. In dieser Zeit war ich vor allem im Luft- und Seefrachtbereich tätig. Später ging es über Italien zurück nach Deutschland, wo ich viele Jahre als Geschäftsführer in einem Logistikunternehmen tätig war. Heute bin ich selbstständiger Berater – mit dem Ziel, meine Erfahrung weiterzugeben und Unternehmen in der Logistikbranche zu begleiten.
Wie steht es aktuell um den Seefrachtmarkt: Kehrt Ruhe ein oder bleibt es turbulent?
Aktuell ist es stabiler als direkt nach der Pandemie, aber von echter Ruhe kann keine Rede sein. Politische Spannungen, Handelskonflikte und neue Regulierungen sorgen weiter für starke Schwankungen. Wegen der Angriffe auf Handelsschiffe durch Huthi-Rebellen vermeiden viele Reedereien die Passage durch den Suezkanal. Die Schiffe werden über Südafrika umgeleitet. Das verlängert Transportzeiten, was vor allem für verderbliche Waren wie Lebensmittel eine große Herausforderung ist. Und: Es treibt die Kosten in die Höhe.
Können Sie uns konkrete Zahlen nennen?
Das Rote Meer wickelte vor der Krise rund 30 Prozent des globalen Containerverkehrs ab. Anfang 2025 umgingen bereits 85 bis 90 Prozent der Schiffe die Route durch das Rote Meer und fuhren stattdessen am Kap der Guten Hoffnung entlang – mit bis zu 20 Tagen längerer Transitzeit und rund 1 Mio. USD zusätzlichen Treibstoffkosten pro Reise.
Auch aus den USA kommt derzeit Unsicherheit. Spüren Sie das im Markt?
Absolut. Vor allem unter Donald Trump sind viele Entscheidungen völlig unberechenbar. Zölle von bis zu 70 Prozent werden quasi über Nacht verhängt – da ist die Ware oft schon unterwegs. Und wenn sich die Rahmenbedingungen mitten auf dem Wasser ändern, müssen Container zurück oder umgeleitet werden. Das ist nicht nur logistisch komplex, sondern auch extrem teuer – vor allem, wenn der betroffene Container ganz unten im Stapel liegt und erst alle anderen runtergehoben werden müssen.
Wie planbar sind internationale Lieferketten derzeit?
Lieferketten sind planbarer als während der Pandemie, aber von echter Stabilität sind wir noch weit entfernt. Flexibilität, Echtzeit-Transparenz und alternative Routenplanung sind heute zentrale Anforderungen im Supply Chain Management. Unternehmen, die auf eine engmaschige digitale Überwachung setzen, können schneller reagieren und Risiken besser steuern. Insbesondere die Hafenlogistik macht eine Planbarkeit der Lieferkette sehr schwierig. Es gibt große Kapazitätsengpässe bei der Hinterlandanbindung. Es fehlen Fahrer, aber auch spezielles Equipment wie Gensets*. Auch der Abfluss über die Bahn wird regelmäßig durch Gleisstörungen oder Schienenbauarbeiten negativ beeinflusst.
Haben sich die Preise inzwischen stabilisiert?
Nicht wirklich – es gibt weiterhin deutliche Schwankungen, insbesondere auf Asien-Europa-Routen. Politische Spannungen, etwa im Nahen Osten oder in der Ukraine, wirken sich ebenso aus wie neue Regulierungen, saisonale Effekte, Kapazitätsengpässe, das Verhalten großer Reedereien, Streiks, wie zuletzt in nordeuropäischen Häfen, und die CO₂-Abgabe. Hinzu kommen steigende Kosten durch technische Vorgaben – etwa beim Einsatz emissionsärmerer Treibstoffe. Der Umstieg ist teuer und in vielen Fällen wirtschaftlich kaum darstellbar. Nur eine Zahl dazu: Vor der Pandemie lag der Containerpreis etwa von Shanghai zu den nordeuropäischen Mainports bei durchschnittlich USD 1.400 per 20-Fuß-Standardcontainer (TEU). Heute liegt er etwa 20 Prozent höher.
Wie groß ist das Interesse Ihrer Kund:innen an klimafreundlicher oder CO₂-neutraler Logistik?
Nachhaltigkeit gewinnt massiv an Bedeutung, der Druck wächst spürbar: Kunden fordern CO₂-Angaben im Angebot und Nachhaltigkeit wird zum Wettbewerbsfaktor. Bei Frachtausschreibungen wird nicht mehr nur nach den günstigsten Preisen für den besten Service bewertet, sondern auch nach dem niedrigsten Emissionsausstoß bewertet. Aber sobald es ums Geld geht, zeigt sich die Realität – ist der grüne Anbieter teurer, fällt die Wahl oft trotzdem auf die günstigere Option. Am Ende zählt für viele eben doch der Preis, nicht die Umweltbilanz. Ein großes Problem ist die Loyalität der Kunden: Viele fordern grüne Flotten mit LNG-Antrieb – aber als die Gaspreise während der Energiekrise explodierten, war kaum jemand bereit, die Mehrkosten zu tragen. Viele Speditionen mussten ihre gasbetriebenen Fahrzeuge abstellen. Dennoch gibt es vielversprechende Ansätze: In den Niederlanden etwa fährt ein erstes emissionsarmes Containerschiff – finanziert gemeinsam von Spediteur und Kunde. Ohne solche Partnerschaften wird es künftig nicht gehen.
Sehen Sie noch weitere Fortschritte bei alternativen Antrieben?
Ja, insbesondere bei LNG-Antrieben. Die Nutzung von Methanol und die ersten Konzepte für wasserstoffbasierte Antriebe gewinnen an Bedeutung. Der Binnenhafenbetreiber Moerdijk Container Terminal (NL) hat für seine Bargeroute nach Rotterdam Binnenschiffe mit Elektroantrieb im Umlauf. Auch Windkraft wird – etwa durch Rotorsegel – wieder als ergänzende Technologie diskutiert. Allerdings stehen viele dieser Technologien noch am Anfang oder sind auf bestimmte Schiffsklassen beschränkt.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung in der Branche?
Eine zentrale. Ohne digitale Prozesse würde die Branche heute kollabieren. Track & Trace, automatisierte Abläufe, digitale Schnittstellen – nur so lässt sich das immense Volumen trotz Personalmangel überhaupt noch bewältigen. Trotzdem gibt es noch Potential nach oben, etwa bei der durchgängigen Integration von Zoll- und Dokumentenprozessen. Häfen wie Rotterdam oder Antwerpen haben eine sehr effiziente digitale Plattform, die eine effiziente Planung der Hafen- und Hinterlandlogistik erlaubt.
Wie beurteilen Sie die Zukunftsfähigkeit des Hamburger Hafens?
Hamburg bleibt ein zentraler Knotenpunkt, aber die Herausforderungen sind groß. Die Hinterlandanbindung ist lückenhaft, Wartezeiten von 40 bis 60 Stunden sind keine Seltenheit. In Sachen Digitalisierung hat Hamburg zwar aufgeholt, liegt aber immer noch hinter Rotterdam und Antwerpen. Das schlägt auf die Kosten und erhöht den Druck im internationalen Wettbewerb.
Kann Wilhelmshaven da eine Alternative sein?
Potential ist da, aber die Realität hinkt hinterher. Es fehlt an Infrastruktur und Anbindung. Hätte man den Hafen näher an die großen Wirtschaftszentren gelegt, wäre mehr drin gewesen. So bleibt Wilhelmshaven ein ergänzender Standort, aber kein ernstzunehmender Ersatz für Hamburg, Rotterdam oder Antwerpen.
Was sind für Sie die drängendsten Probleme der Branche?
Ganz klar: der Fachkräftemangel. In Regionen wie München oder Stuttgart ist es fast unmöglich, ausreichend qualifiziertes Personal zu finden. Gleichzeitig nimmt die regulatorische Komplexität zu – etwa durch das sogenannte „Kassel-Gesetz“. Gemeint sind strengere EU-Regeln zur Kabotage*. Wir müssen meiner Ansicht nach Kabotagebestimmungen ändern oder abschaffen und endlich Transportunternehmen aus den baltischen oder südosteuropäischen Ländern frei in Hamburg, Antwerpen oder Rotterdam fahren lassen. Früher konnten ausländische Fahrer mehrere Transporte innerhalb Deutschlands übernehmen. Heute sind maximal drei Fahrten in sieben Tagen erlaubt – danach muss eine mehrtägige Pause eingelegt werden. Das macht die Planung deutlich komplexer und verteuert die Transporte spürbar.
Gibt es auch Lichtblicke, also echte Vorzeigeprojekte in der Branche?
Ja, aber viele stecken noch in der Pilotphase. Es gibt erste Ansätze, Leerfahrten zu vermeiden – etwa durch intelligenteren Containerumschlag. Auch alternative Antriebe in der Binnenschifffahrt machen Fortschritte. Aber klar ist: Ohne Kunden, die mitziehen und mitinvestieren, bleibt vieles Stückwerk. Allein kann der Dienstleister die Transformation nicht stemmen.
*Gensets = Abkürzung für Generatorenset – also ein Motor, der einen Generator antreibt und beispielsweise Strom für Kühlcontainer während des Transports zur Verfügung stellt, wenn keine externe Stromquelle vorhanden ist.
**Kabotage = Transport von Gütern innerhalb eines Landes durch ausländische Verkehrsunternehmen.
Zur Person: Olaf Böhm
Olaf Böhm ist ausgebildeter Speditionskaufmann und verfügt über fast 35 Jahre Erfahrung im internationalen Logistikmanagement. Seine Karriere führte ihn über knapp zwei Jahrzehnte durch verschiedene europäische Märkte – darunter Großbritannien und Italien – sowie nach Asien, insbesondere nach Hongkong und Südkorea. 2012 übernahm Böhm im Rahmen einer Nachfolgeregelung die Geschäftsführung eines Münchner Logistikunternehmens mit Fokus auf Lebensmittellogistik. Ein Jahr später wurde er Gesellschafter. In seiner elfjährigen Führungstätigkeit gestaltete er die organische Expansion des Unternehmens von zwei auf elf Standorte in acht Ländern maßgeblich mit – bei einem Umsatzwachstum von rund 80 auf knapp 300 Millionen Euro. Ende 2023 verkaufte Olaf Böhm seine Anteile. Heute begleitet er Unternehmen als Berater in strategischen Wachstums- und Transformationsprozessen – mit besonderem Fokus auf Logistik, Supply Chain Management und internationale Märkte. Sein Unternehmen sitzt in Aßling bei München. Weitere Infos: www.bo-log-consulting.com